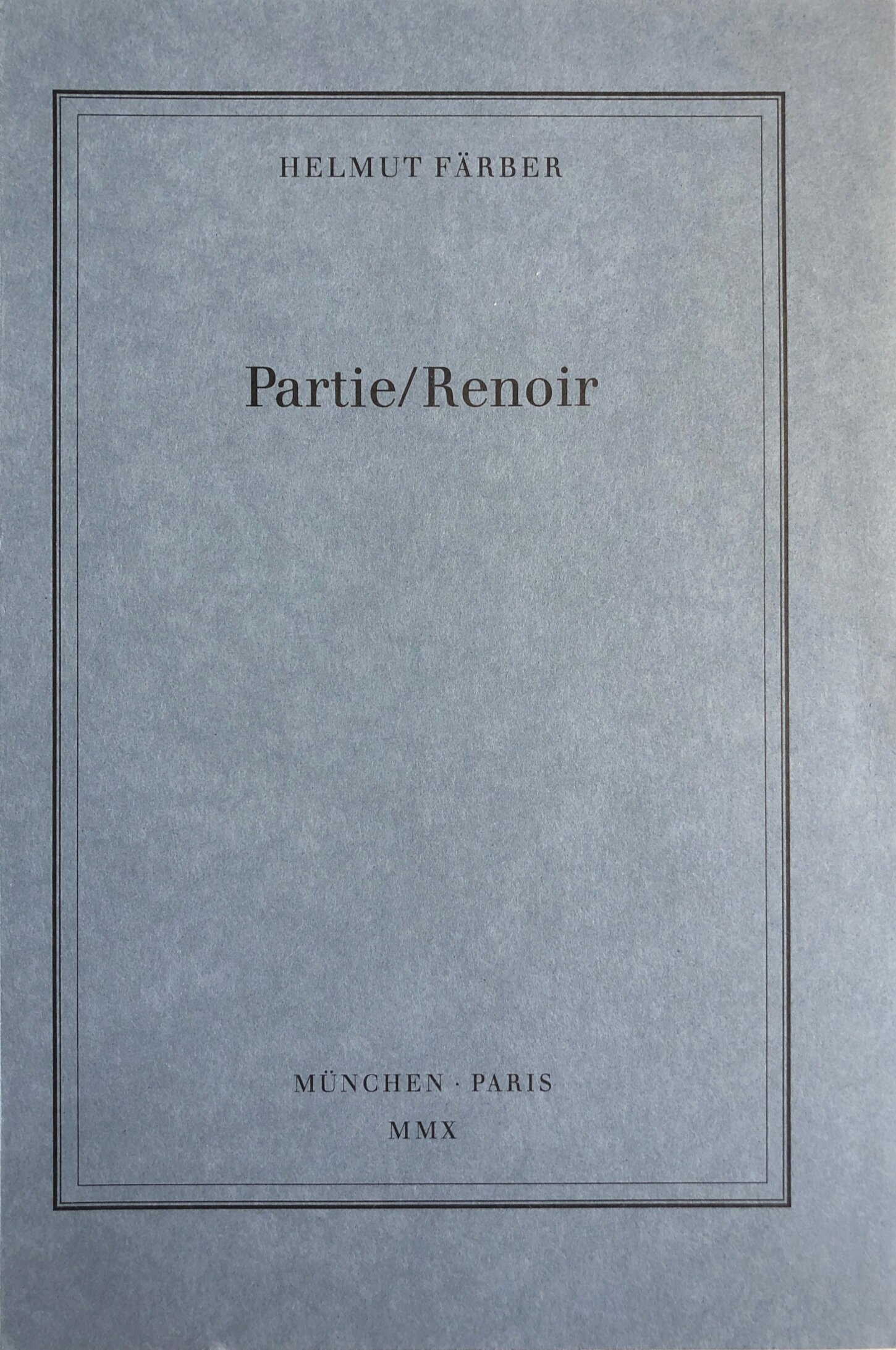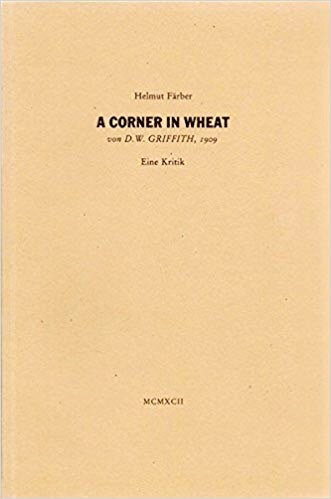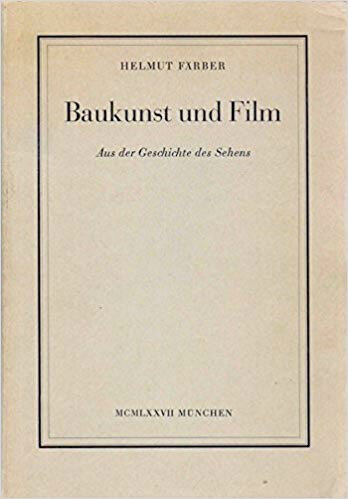Helmut Färber
Petrarca Preis, 1994
Ausgewählte Publikationen
Peter Handke
Wie ein Letzter, ein Erster
Laudatio auf Helmut Färber
Vor jedem Worte-Machen zu etwas, das mich auf die Beine gebracht hat, ist da der Gedankenzwist, ob es nicht richtiger wäre, die Sache auf sich beruhen und so in Ruhe blühen zu lassen. Und in der Sache Helmut Färber ist solcher Zwiespalt besonders wirksam. Ich habe zu kämpfen mit einem Widerstreben, öffentlich vom Werk dieses Mannes zu reden. Das hat einmal allein schon zu tun mit der Person, welche jede Art von auf-sich-gerichtetem Ritus sich vom Leib zu facheln scheint. (Dazu gehört, daß Helmut Färber mit allen seinen Sinnen eben ein Ritenerforscher ist. Und dann sind es auch die Sachen, ist es die Arbeit des bestimmten Menschen da selbst. Sie spricht derart für sich allein, und strahlt überdies eine solche Gewissenhaftigkeit aus, daß ein jeder Zusatz, wie etwa der meine hier, mit der Gefahr sowohl des Drumherumredens als auch der Oberflächlichkeit oder Sprunghaftigkeit zu tun bekommt. Andrerseits ist Drumherumreden vielleicht doch etwas anderes als Zerreden, und Oberflächlichkeit von Fall zu Fall etwas anderes als Leichtheit, und Sprunghaftigkeit nicht ganz gleichzusetzen mit Schlamperei. Und überdies will - stärkerer Antrieb als der, die nun dreißig Jahre der Taten Helmut Färbers einfach schweigend auf mich einwirken zu lassen - zu diesem endlich einmal auch was gesagt sein.
Wer ist Helmut Färber? Beim Lesen bin ich ihm zuerst begegnet als einem Filmkritiker, Mitte der sechziger Jahre, in der Süddeutschen Zeitung« und der Monatszeitschrift »Filmkritik«. Zu Filmen, gleich welchen, eine solch feine und zugleich bodenständige Sprache zu Gesicht zu bekommen, und das auch noch in einer Tageszeitung, das hat mich damals wachgestoßen, fürs Filmeanschauen, aber auch für das Tun und Schreiben, und ich weiß es, nicht nur mich. Oft waren das nur ein paar Zeilen im Lokalfeuilleton, wofür Helmut Färber, bei einem Zeilenhonorar von einer (1) DM, vielleicht zwischen 8 und 10 Mark ausbezahlt bekam. Eine dieser Filmbesprechungen ging zum Beispiel so:
»Stern des Südens. Das wäre schön: Man wäre eben noch in München über den Karlsplatz gegangen, dann in den Stachus-Filmpalast und befinde sich plötzlich, wiewohl noch am Karlsplatz, zugleich im fernen Afrika und erlebte dort die abenteuerliche Suche nach dem verschwundenen Diamanten Stern des Südens. Das wäre schön und könnte geschehen durch einen Film, wenn in ihm sichtbar würden zum Beispiel:
Sand; Weite; das Gehen durch den Busch; Herauskommen aus dem Wald; Ermüdung; Schatten; wie eine geflochtene Hängebrücke sich bewegt. Wer nicht filmen mag, wie sie sich bewegt, muß, damit er auch etwas hat, filmen, wie sie kaputtgeht. Wie dieser Film ...
>Liaodschaidschigi<, das ist der Titel einer Sammlung von Erzählungen aus dem chinesischen 17. Jahrhundert und heißt zu deutsch: >Seltsame Geschichten, aufgezeichnet im Studio der beschaulichen Mußes. Es könnte den Film geben, der so hieße. Seltsame Geschichten, gefilmt im Studio der beschaulichen Muße.< (Ohne Datum, irgendwann in den sechziger Jahren ...)
Oder so:
»Erpressung durch Scorpio (City) ... Nur müde soll man werden und sich gewöhnen an schlechte Büros und Filme. Aber man muß es nicht. Es gäbe etwas, das unterhaltend und anders ist, wirklich phantastische Abenteuer- und Liebesgeschichten: jetzt gerade gibt es im Insel-Verlag eine sehr schöne, nicht teure Ausgabe der Erzählungen aus 1001 Nacht Wer abends in diesen Geschichten läse, täte sogar noch etwas für die Filmindustrie; denn manchmal fiele ihm dabei vielleicht ein, wie Filme sein könnten, wie sie bloß nicht sind.« (31.10.68)
Oder so, unter der Überschrift »Marktbericht«:
»Woody und seine Freunde (Royal Theater). Witzzeichenfilme, zusammengehauen, Produkte üblicher Abfallproduktion. Kindern soll man lieber Märchen erzählen und die Donald Duck-Sonderhefte« (im Zeitungsdruck dann verändert zu: »oder notfalls die Donald Duck-Sonderhefte«) »kaufen. - Mehr ist zu dieser Chose nicht zu sagen: wer bei nichtvorhandenen Filmen als Kritiker jedesmal wieder pflichtbewußt herumredet, verfehlt seinen Beruf und demoralisiert die Leute, die Kritiken lesen, und denen ich zu dienen hoffe, indem ich ihnen sage: >auf dem Elisabethmarkt, an einem bestimmten Stand in der zweiten Reihe, gibt es besonders schöne Artischocken.<« (15.7.68)
Oder aber so, als Ausschnitt zitiert, unter der Überschrift »Dracula und Adalbert Stiftere:
»Wie schmeckt das Blut von Dracula ... Im Wald ist alles stumm. Kein Vogel. Der Wind bewegt die Zweige und in zitternden Linien das Wasser des Waldteichs. Auch er ist lautlos. Wie ein Wild, horchend und blickend. den Jäger spürt, der es töten wird, so spürt in solchen Bildern die Natur des 19. Jahrhunderts den Tod voraus, den das 20. ihr bereitet hat. Graf Dracula, der plötzlich zwischen den Bäumen steht, im schwarzen Mantel, aschfahl, gezeichnet vom endlosen Martyrium der Langeweile, ist eine der letzten Wunschfiguren des bürgerlichen Europa und als Wunschfigur ein so aufrichtiges Geständnis, daß die Todeserzählungen Thomas Manns davor für mich als Schweinerei erkennbar werden. Und Adalbert Stifters Wahrhaftigkeit wird ganz deutlich.« (Sept. 1970)
Oder aber so - ich möchte weiter zitieren, wenn auch wieder nur einen Ausschnitt:
»Donald Duck als Sonntagsjäger (Mohren) ... Außerdem gibt es Donald Duck, unter anderem in kurzen Filmen wie diesen. Hier ist er unsympathischer, bösartiger, eindimensionaler (als in den Comicsheften vorhanden, mehr nur als motorisches Prinzip. Diese Filme sind kleine Maschinen, die sich in wahnsinniger Geschwindigkeit verwandeln und zerstören - es steckt viel Spezialistenintelligenz darin. Das Material, aus dem sie bestehen, ist eine von keiner Hoffnung mehr erreichte, eine sozusagen gegenstandslose und deshalb sich auf alle Gegenstände wie ein Geier stürzende Phantasie.
Mehr als zwei dieser aufschlußreichen Filme hält man in wachem Zustand hintereinander nicht aus. Zu sehen sind an die zehn.« (Ohne Datum)
Gar zu selten, für mich jedenfalls, erschienen in der Zeitung regelrechte, langere Filmartikel von Helmut Färber, und sie waren mir immer gar zu schnell zu Ende. Auch sie hatten das Kürzelhafte seiner Anmerkungen und bestanden wie diese aus lauter Abweichungen, so leichten wie ernsten, die Sache ins Weite oder Rechte rückenden. Zwischendurch berichtete er etwa noch von einem Science-Fiction-Filmfestival in Triest, das dort im Süden nächtlich draußen im Burghof stattfand, wenn dann in dem Geschriebenen auch kein einziger Film vorkam, dafür der Mond über der Leinwand und vor allem ausführlich beschrieben, ein Schaufenster in der Triester Innenstadt mit phantastischen Weltraumfiguren, geknetet, händisch, aus Marzipan, samt Nachtbeleuchtung
Nicht nur Filme erzählte Helmut Färber einem damals vor in der Zeitung. Als gelernter Drucker, dann Kunsthistoriker, befaßte er sich auch mit Büchern, und zwar auf eine ganz neue, ein Beispiel gebende Art (nur wurde seinem Beispiel dann kaum gefolgt). Erst einmal ließ er die Bücher, in der Hauptsache durch ein immer gerechtes, »aufschlußreiches« Zitieren, für oder von sich selber sprechen und unterbrach sie gleichsam bloß mit seinen bescheidenen, bildhaften, andeutenden Zwischentiteln. Und dann bestimmte er, der Verfasser, auch noch die Typographie jeweils der Artikel, verantwortete deren Aussehen, hatte den Rhythmus von Text und Illustration ganz in seiner Hand. So wunderbar licht und tiefgründig zu lesende Absätze, so ein schönes Mit-, In- und Auseinander von Bildern und Lettern wie seinerzeit Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre bisweilen in einer Wochenendausgabe der »Süddeutschen Zeitung«, standen wohl weder vorher noch nachher je in einem Journal. Solche Seiten, von dem Drucker, Kunstwissenschaftler und Schreiber (im altägyptischen Sinn) Helmut Färber entworfen und praktiziert zugleich, waren, ob es um den Nachdruck eines Warenhauskatalogs vor dem Ersten Weltkrieg ging oder ein Schlüsselbuch zur Eroberung des amerikanischen Westens, ein zauberisches Aufblättern zu einer Welt, in welcher Zeitung und Buch einmal als zwei durchaus benachbarte Gärten aufblitzten.
Mehr umfassend, auch gleichmäßiger, war Helmut Färber zu jener Epoche zu lesen in der Zeitschrift »Filmkritik«, Deren Ruhm wird einmal jemand andrer verkünden. Zusammen etwa mit dem mürrischen oder schüchternen Enno Patalas als dem Herausgeber, der ihre Filme umspielenden Frieda Grafe, dem zwanglos eleganten, dabei großäugigen, Uwe Nettelbeck, dem anmutig-zornigen, St.-Georg-haften (entsprechend sein Schreibstil) Filmliebhaber Herbert Linder, veröffentlichte da Helmut Färber, ungefähr von 1964 bis 1975 seine immer grundsätzlichen, dabei immer die Schwebe einhaltenden Aufsätze zu Die Rote Wüste von Michelangelo Antonioni, zu Le Mépris von JeanLuc Godard, zu den amerikanischen Western, zu Buñuel (nein, das konnte noch in der SZ stehen), seinen Versuch über Hitchcock und, ein Vorbild nicht nur für jede Kritik, sondern überhaupt fürs Schreiben und Machen, seine Beschreibung (in dieser begriffen die Deutung) von Straubs Die Chronik der Anna Magdalena Bach.
In den Jahrzehnten seither hat sich das Schreiben über Filme von Grund auf verändert. Zeitschriften wie die »Filmkritik« gibt es nicht mehr. »Les Cahiers du Cinéma« in Frankreich werden zwar weiter publiziert, aber selbst da hat die Haltung zu den Filmen und dem Kino sich wesentlich verwandelt. Wie bei einem jeden Produkt scheint es die Regel auch für die Filme geworden zu sein, daß diese erst existieren durch diejenigen, die dazu etwas sagen und zugleich auch noch das Sagen haben, die Schalt- und Schalterstellen, die Veröffentlicher oder eher Öffentlichkeitsagenten. Höchstens als Rhetorikfloskel käme in deren Suada ein Zeitwort wie Helmut Färbers »dienen« vor. Mit dem, was sie tun, sowohl einem Werk als auch einem Publikum zu dienen, hielten sie für ein Ansinnen aus einer Urzeit. In ihrem Selbstverständnis sind sie, die öffentlichen Meiner zu einer Sache, deren Macher, und nicht etwa der Regisseur oder die Mannschaft des Films. Die Cineasten, das sind sie, und nicht Robert Altmann oder Ken Loach. Bedenklich ist das mit so vielen der jetzigen Filmkritiker, denen die eigene Intelligenz so viel mehr gilt als die Gedanklichkeit oder die Denkhaltung, die so andersartige Intelligenz in ihrem jeweiligen Gegenstand. In ihrem Schreiben über Filme mit nichts unterwegs als mit ihrem lieblosen Scharfsinn, wirken solche Schalterleute zunächst fast wohltuend frech, dann zerstörerisch dumm; und zuletzt nur noch haltlos hysterisch. Es ist vielleicht nicht so schlimm, und doch ist es schlimm: es ist das falsche Gewicht. Helmut Färber hat dergleichen, mehr analytisch und umfassend, in einem seiner letzten Aufsätze für die »Filmkritik«, im Septemberheft 1975, gewaltig angedeutet (»Einige Notizen über amerikanische Western«):
» ... man sieht [in den Western), wie verschiedene Leute sich verhalten, und sieht sie handeln ... Das Bewußtsein hier behält von den Western nicht dies, Verhalten und Handeln, sondern erzeugt Prinzipien von Verhalten und Handeln. Diese Umwandlung von Verhalten und Handeln in Prinzipien und Standpunkt geschieht durch intellektuelle Leute ... dieses Verwischen des Unterschiedes zwischen Handeln und Standpunkt, Sehen und Meinen ist die Ware, die sie besser verkaufen als alle ihre anderen ... Sie stellt ein reichliches Leben her... große Eindrücke, wo nichts davon da ist. Diese Ware ist für [diese] Leute nicht nur die verkäuflichste, sie ist die einzige, die ihnen eine weitere Teilnahme am Wirtschaftsleben sichert ... Sie läßt die riesigen Entbehrungen, die es auferlegt, verschwinden, und trägt dazu bei, daß Unruhe und Unzufriedenheiten sich weniger in Handlungen als in Stand punkten ausdrücken.«
Immer wieder hat Helmut Färber diese bestimmte, so gegenstands- wie blicklose Intelligenz kritisiert, und immer doch eher, bei allem Zorn, beiläufig und nebenbei. Seine höchsteigene Intelligenz galt hauptsächlich den Dingen und Werken, denen er zugeneigt war. Sein Scharfsinn ist insbesondere einer, der aus dem Enthusiasmus kommt: Hand in Hand mit diesem zeitigt er im Schreiben die so spezifisch Färbersche Melodie, die Bildlichkeit, die Gegenständlichkeit. Helmut Färber ist ein märchenhafter Filmkritiker und Satz für Satz auch noch etwas anderes. Umgekehrt hat er bei all den Filmen und Autoren, die er erfreut begrüßte - freudiges sachgerechtes Begrüßen, so könnte der gemeinsame Nenner seiner Artikel heißen-, keinmal das Maß verlassen; ist nie durch Überschwang unglaubwürdig; bleibt immer zugleich der nüchterne Unterscheider, der Kritiker; seine Strenge, paradoxes Verb für dieses Substantiv, spielt verläßlich mit, es ist da oft eine barmherzige Strenge. Wie vielfältig und gewissermaßen geleitschützerisch fächert er die Struktur etwa von Godards Le Mépris einem zum Lesen auf, wie nennt er das ausdrücklich Kulissenhafte des Films »ein wunderbar erleichterndes Vergnügen ...«, wie goetheisch angemessen gewunden wird des Kritikers Sprache, wenn er auf Godards »Weise des Zitierens« kommt, »die einen so freundlich stimmt, die den Betrachter aufs Schönste veranlaßt, sich beständig umzustellen« - und doch gehört zu solchem Gruß auch die ihn beschließende Einwendung, so: »Die Weise des Zitierens sollte die Blicke nicht trüben für die Dürftigkeit des Zitierten. Denn mit dem Hölderlin etwa, der laut Godard keine Bedeutungen gesucht habe, da ist es eben so eine Sache. Daß Hölderlin keine Bedeutungen gesucht hat, wie beispielsweise Leo Krell sie haben will, mit dessen Literaturgeschichte seit Jahren an Höheren Schulen die Liebe zur Literatur bekämpft wird, darüber ist nicht zu reden ... Es fragt sich nur, ob Ahnungslosigkeit wirklich jene Alternative ist, als die sie in Le Mépris erscheint... [Godards] Romantisieren fehlt, um ... Friedrich von Hardenberg zu zitieren, die beste Pointe: > Verwandlung des Fremden in ein Eigenes, Zueignung ist also das unaufhörliche Geschäft des Geistes<.« - Und so weisen auch die meisten an. deren Begleitschreiben Helmut Färbers ihr Maß an Bedenken angesichts des Gegenstands ihrer Zuneigung, bei Antonioni ebenso wie bei Hitchcock und Walt Disney (zum Dschungelbuch: »Disneys Phantasie hatte sich von den Filmen weg auf anderes gerichtet. Und sie kann nicht seinen Tod überleben... Darum sind die Elefanten und Geier so schlecht den Elefanten und Raben aus Dumbo nachgemacht... Selbst wenn die singende, hypnotisierte Schlange... lustig dreinschaut, schaut sie nicht mehr so lustig wie das Krododil in Peter Pan«). - Ganz ohne Einschränkung übermittelt Färber einem, nach den Pionieren wie Griffith und Eisenstein, eigentlich nur drei Regisseure: Yasujiro Ozu, John Ford, Jean-Marie Straub. Aber auch da bleibt er, und das ist seine Kunst, mit der Ergriffenheit rein bei der Sache. Bei Ozus Ukigusa (Schwankendes Schilf) so:
»Es ist die Form, die Ozus Episoden in reine Wahrheit verwandelt. Un bewegt, unverwandt stehen die Bilder... Immer wieder geben Bilder, vollkommen ohne Bewegung, sekundenlang stillstehend, auch optisch Pausen. Aber dies sind nicht Pausen, in denen Leere einbricht, sondern Momente der Sammlung. Ozus Bilder wären nicht denkbar ohne die ja panische Architektur. Ihre rechtwinkligen, flächenhaften Holzgerüste und -rahmen, fast immer bildparallel gesehen, entfernen jegliche Zufälligkeit. Ihrer Ordnung sind die Personen eingeschrieben, genau frontal, oder genau im Profil... Was Ozus Menschen höchstens von Ferne ahnen und was man zerstören würde, wenn man es zu behaupten wagte, vermag diese Form zu vergegenwärtigen: daß Resignation zu tun hat mit Überwindung.« (Und dann erst erlaubt sich Färber, zu sagen:) »Schwankendes Schilf ist einer der schönsten Filme, die in den letzten Jahren in München zu sehen waren. Es ist die Schönheit jenes Übergangs, an dem man, wie Ernst Bloch gesagt hat, nicht mehr weiß: ist hier Klage oder Trost<.« (Das hat der Kritiker zuvor schon selber sozusagen sachdienlicher formuliert:) »[Ozu] beschreibt Episoden mit einer Ruhe, die sich nicht erbittern läßt.« (So hat es im übrigen bis heute auch Helmut Färber gehalten.)
Zu John Ford hier nur Färbers Rahmensätze, fundamental. Die des Anfangs: »Man kann sich eine spätere Zeit vorstellen, die das 20. Jahrhundert um eine Sprache beneidet, die es dann nicht mehr gibt: um den Film. Menschen werden beklagen, daß wir diese Sprache kaum mehr zu gebrauchen wußten. Und die des Endes: »Nur bei einem sehr guten Film hat man Lust, zu beschreiben. Beschreiben ist etwas ganz anderes als Nacherzählen. Und für Leser, die finden, hier sei über einen Film dies und jenes gesagt, aber nicht recht, was er insgesamt ist: Ein schöner Film, den man nicht nur von außen ansehen kann, man kann in ihm herumgehen!« (Ich glaube, das ist in dem Schrifttum Helmut Färbers das bisher einzige Rufzeichen.)
Und dann noch Helmut Färber zu Straub-Huillets Die Chronik der Anna Magdalena Bach. Es ist das pure Kritik in Gestalt eben jener Beschreibung. Und Beschreibung heißt Formerforschung, Einstellung um Einstellung, und deren sprachliche Nachzeichnung; kontrapunktiert durch äußerst bedachtes, gegenstandsgemäß ausgewähltes Zitieren. Urteil, Kommentar, Zuschauerreaktion keinmal vordringlich, vielmehr höchstens als eine Weise des Mitgehens mit dem Film, und dann auch nur in Ausnahmemomenten, spärlichen, und dafür um so glaubhafter, etwa: »... so bleibt im ganzen Film kein Bild, kein Wort, kein Augenblick für sich, Besitz. Jedes wird, anderes und durch anderes sich verwandelnd, vollkommener es selbst, und Sprache, wie es freilich noch kein Film gewesen ist, auch durch Eisenstein noch nicht. Sprache, die zugleich Handeln ist.« (Ähnliches sagt Färber von der Sprache in den Western.) »Bach hat seine Zeit nicht versäumt, die Chronik der Anna Magdalena Bach wird gegen Ende immer rascher, die Zeit des Lebens, im Film gemessen durch die Musik, ist erfüllt, und der Film erreicht eine Ruhe, wie er am Ende des Eingangschors der Matthäuspassion jenes Bild eines Sonnenaufgangs an einem Meer erreicht, durch welches alle gefilmten Sonnenauf- und untergänge wider den Geist nicht mehr da sind.« Oder so erlaubt sich der Kritiker zu der Einstellung, wo Bachs Frau ihrem Mann ganz kurz die Hand auf die Schulter (legt)«, dann sein ebenso kurzes erscheint jenes einzige sichtbarste Zeichen der Liebe«. Die Regel der Kritik aber bleibt die Beschreibung der Film erweckt diese im Zuschauer Kritiker auf das natürlichste, als den Konvoi, welchen er sowohl braucht als auch verdient; das Zuschauen allein genügt nicht; das unterscheidende Beschreiben will hinzutreten: die von dem Gegenstand durchdrungene, ergriffene, mächtig erschütterte, zugleich vor ihm in den Abstand tretende und vernünftige Kritik.
So las ich Helmut Färber immer eben als jemand noch anderen als einen Kritiker. Es ist heute auch der Augenblick, zu sagen, wie seine Schriften mir Schubs um Schubs gegeben haben, sowohl auf die eigenen Augen und das Herz zu bauen, als auch dabei nicht den Sprachverstand zu verraten. Ohne ihn hätte ich zum Beispiel den Kurzen Brief zum langen Abschied nicht geschrieben, oder jedenfalls wer weiß wie, Und ich bin nicht der einzige, der von seinem Tun und Auslassen (das zählt genauso etwas gehabt hat. Ich begehe keinen Verrat, wenn ich sage, daß seine Weise des Arbeitens (oder, im Sinn der amerikanischen Westernfilme, sein Verhalten) für die Anfänge von Wim Wenders, der im übrigen eine Zeitlang damals für die »Süddeutsche« neben Färber Filmkritiken schrieb, so etwas wie- wenn es das gäbe - eine Bildergabel war. Und das von Helmut Färber, statt der ausgedienten Regelästhetik, für die Kritik frei nach Friedrich Schlegel vorgeschlagene »Spiel der Mitteilung und Annäherung«, von ihm selber befolgt in einem immer noch leuchtenden Ring von Beispielen, hat, kommt mir vor, doch diesen und jenen jüngeren Kritiker auf einen frischen Weg gebracht: ich denke etwa an Benjamin Heinrichs' so erfreulichen Aufsatz zu Stan Laurel & Oliver Hardy, auf welche Färbers Forderung zutrifft, Filmkritiken sollten, »was sie finden und fordern«, auch selber sein.
Helmut Färber ist dabei freilich ein grundanderer als du und ich; ein ganz eigener, auch eigensinniger, der formulierte Eigensinn. Zugleich ist er universell. Wenn er sagt: »Was heute Kritiken des Argumentierens zu viel tun, an Nähe des Beobachtens gebricht es ihnen«, so redet er nicht einem zeitenthobenen reinen Sehen das Wort. Daß ein Werk sich sehen läßt, macht zwar überhaupt für ihn erst seine Kritikwürdigkeit aus, aber die Zeitumstände müssen in der Betrachtung mit dabei sein; Kritik ist für ihn: Verstehen und Historik. Insofern beharrt Färber für sich auf der Wissenschaftlichkeit. Was ihn dabei von einem Filmwissenschaftler wie Siegfried Kracauer unterscheidet, ist sein entgegengesetztes Gewichten - entsprechend wie er selbst von Kracauer sagt: »Er trifft den Zeitgeist eines Werks, nicht den Geist.« In seinem Grundlagenerforschen wie auch seiner Art des Gewichtens ist Helmut Färber am ehesten der Bruder Walter Benjamins; ebenso in dem fragmentarischen Charakter manch seiner Sachen - es ist keine Schande, wenn jemand zu einem Film sieben einzelne Gedanken einfallen« - und in dem anmutigen Einssein von Begrifflichkeit und Anschauung (bei Färbers Sprache, kommt mir vor, noch vollkommener, sowohl erdiger wie luftiger, und wohl nicht nur wegen seiner Abstammung aus Regensburg und von Karl Valentin; bei ihm käme niemand in Versuchung, von einer »Sprachbehandlung« zu reden, wie leider ich doch gar zu oft bei Benjamin: Färber läßt die Sprache handeln, aus einem Universal- oder, s.o., Westerner- oder Poeten-Instinkt, und desgleichen weiß er spürbar weit mehr, als er sagt, indes sein Vorfahrbruder jeweils so ziemlich alles sagt, was er weiß, und manchmal noch mehr).
In Wahrheit ist Helmut Färber mit gar niemand zu vergleichen. Es ist noch eine Dimension an ihm, welche ihn nicht nur von den Kritikern jetzt der neunziger Jahre unterscheidet, sondern auch von seinen Vorgängern und ebenso seinen Mitspielern seinerzeit in der Filmkritik«. Sein Blick war, und zwar von Beginn, mitbestimmt von der Technik und dem Handwerk des Kinos. Er hat neben den Filmen auch Filmlehrbücher aus Hollywood besprochen, zum Beispiel eine Skizze mitgezeigt, wie bei einem Indianerpfeil zwei Kameras und zwei Pfeile die Bilderfolge Abschuß-Treffer herbeizaubern, und zugleich an den wesensverschiedenen Techniklehren aus zwei Büchern, deren Erscheinen nur um ein paar Jahre auseinander war, beiläufig belegt, wie sich eine große Krise der Filmgesellschaften auch auf die Drehregeln auswirkte: das später erschienene Lehrbuch bestand allein aus Ratschlägen zum Zeit- und Materialeinsparen, aber ohne das vorige wäre das nicht so erkennbar gewesen. Helmut Färbers Beschäftigung mit dem Handwerkszeug der Filme ist keine flüchtige Neugier, sondern ein beständiges Interesse, ein beharrliches Bei-der-Sache-Bleiben, ein Teil seines Verstehen, welches er auch darum so fruchten lassen kann, wie, jedenfalls im Deutschen, kein zweiter. Wie wäre es zu wünschen, würden die Leute, die heutzutage was zu Filmen sagen, bei den treusorglich liebevollen Beschreibungen, Auflistungen, Archivierungen, Archäologisierungen Färbers, der tausend Apparate, Gerätschaften, Helferdinge, Helfermenschen für einen einzigen Film jahrlang zur Schule gehen; wie würden ihre blödlässigen ahnungslosen Kintoppvisagen, wie würde ihre von keinerlei Augenzeugenschaft beleckte Cineastenhoffart »sich umformen« (ein häufiges Wort bei Färber) in etwas ganz anderes, welches sie erst zum Kritikmachen in meines Freundes Sinn befähigte: »wachrufen die Selbsterkenntnis des Kunstwerks«.
Es kam dann etwa Mitte der siebziger Jahre die Zeit, da das störrische und dabei doch so sachgerechte wie belebende Deutsch Helmut Färbers nicht mehr zusammenging mit dem Zeitungsdeutsch, nicht einmal dem der spielfreudigen »Süddeutschen«. Und nicht viel später. Anfang der Achtziger?, gab es auch die formenbedachte »Filmkritik« nicht mehr. Färber verlor die für seine Lebensarbeit wesentliche Öffentlichkeit. Das hieß jedoch nicht, daß er, anders als er sich einmal selber bezichtigte, »kleinmütig« oder gar kleingläubig wurde. Schon sehr früh hatte er sich geäußert, die Sache der Filmkritiker werde es mehr und mehr, nach dem Ende des flüchtigen Zusammengehens von Kapitalismus und Phantasie (Hollywood bis in die sechziger Jahre), Filme zu beschreiben, welche es noch nicht gibt. Und das hat er in der Folge auch unternommen, auf eine Weise, auf die nicht »paradox«, vielmehr das alte »dialektisch« zutrifft: Erst einmal hat er sich auf das Lehren konzentriert, an den Filmhochschulen von München und Berlin, ein Lehren allerdings, das, im Gegensatz zu dem von ihm schon lang zornig kritisierten, fast allein aus dem Forschen und die Schüler dabei Zusehenlassen bestand; und dann hat er die künftigen Filme evoziert allein an der Hand der Formenbeschreibungen einiger der wegweisenden frühen und noch früheren samt deren Zeitgeschichte. Einzelnen weit zurückliegenden Filmen galten nun ganze Bücher. Und das sind bis jetzt, nach einem Band »Baukunst und Film. Aus der Geschichte des Sehens« (1977), zwei: Das erste heißt: »Mizoguchi Kenji, Saikaku ichidni onna (Das Leben der Frau Oharu ...). Filmbeschreibung ...« (1986). Und das zweite, erschienen 1992, ebenfalls »Verlag und Vertrieb: Helmut Färber, Fendstraße 4, München 40« »A Corner in Wheat von D. W. GRIFFITH, 1909, Eine Kritik.«
Hier muß jetzt ein Sprung sein. »Baukunst und Film«, wie auch die buchlange Bild- und Wortwiedergabe und sanft aufschlüsselnde Beschreibung des japanischen Films, beides für den, der vom Wissen nicht ein Ohrensausen, sondern ein Beseelen und Sinne Erwecken erwartet, sind, kurz gesagt, dementsprechend zu lesen, zu beäugen, zu buchstabieren, zu studieren. Nur werden andere anderswo sich darüber, wie es sich gehört, äußern und sollten das auch beizeiten tun: ein verändertes Schreiben über Filme wird auch den und jenen neuen Film ermöglichen. Das gilt ebenso für das 131-Seiten-Buch, mit dem stahlstichhaft intensiven Abbildungen sämtlicher Einstellungen, des 15 Minuten und 56 Sekunden kurzen Stummfilms von Griffith. Dieses letztere muß ich aber doch streifen, um besser anzudeuten, wer sein Verfasser Helmut Färber ist. Der Sehdenker, der Bewahrer, der Projektionist (in einem ganz speziellen Filmvorführraum), als der er mir immer vorkam und als der er denen, die lesen, in Zukunft auch ins Licht treten wird, ist in dem Buch da schon nah an der Entfaltung. Zu der Beschreibung des Films tritt hier, im Gegensatz zu der Mizoguchi-Sache, siehe auch den Untertitel, »eine Kritik«. Und was für eine Kritik ist das! Am Beispiel der Erörterung jenes kühnen Pionierfilms greift der Kritiker, beschreibend, vergleichend, unterscheidend, verweisend und insbesondere vor ausweisend, aus in den Weltfilm, in Analogie zu Griffith, welcher eine einzelne Geschichte als »Weltgeschehen« erzählt. Ich möchte dazu wieder nur zitieren aus der Kritik (die Beschreibung des Films geht bis S. 50 - die Kritik von S.55-93; danach »Anhang Daten; Anmerkungen; Überlieferungen und Versionen des Films, Anzeigen - Branchen - Presse; Verbot in Deutschland 1912Zeitpolitisches; Kamera, Photographie, Technisches).
»Das Merkwürdige an so vielem Schreiben über Griffith ist, daß es, im mer interessiert an dem, was die Filmindustrie von Griffith gebrauchen konnte, diese Zerstörung durch die Filmindustrie wiederholt.« (S.55)
»Indem (in den Anfangsbildern die Arbeit des Säens so lange gezeigt wird, viel länger als nötig ist, um sie zu verstehen, wird etwas Feierliches in ihr sichtbar... / Das ist nicht nur der loyale aufrechte Freibauer der populistischen Rhetorik damals in den USA.« (S. 57)
»Für den ganzen Film ist mit diesem Anfang im Freien ein Maß gegeben. Er bestimmt den Rhythmus ... Er bestimmt die Stilhöhe. Die Monumentalität dieses Anfangs bleibt den ganzen Film hindurch gegenwärtig als ein gehaltener Ton.« (S.58)
»Von der Ausbeutung, wie hier durch die Weizenspekulation) läßt sich nicht erzählen, weil mit jeglichem Erzählen sogleich ihr der Anschein eines menschlichen Verhältnisses angefälscht ist ... Im üblichen Fall entsteht die übliche Lüge der sozialkritischen Filme./In A Corner in Wheat bleiben Bauer, Spekulanten und Hungernde einander so unbekannt, wie sie in Wirklichkeit es sind.« (S. 62)
»Bauer, Spekulant, Hungernde: das Einzelne... durch kein Erzählen zu verbinden, für sich allein nicht verständlich - wird erst erkennbar als zusammenhängend durch den Film selbst.« (S. 63)
Zu der berühmten Einstellung der anstehenden Hungernden in dem Bäckerladen, wie sie ohne Brot bleiben und dann, über 12 Sekunden lang, »mit einemmal vollkommen reglos stehen, das ganze Bild völlig reglos«: »Wie der Zusammenhang zwischen Bauern, Weizenkönig und Leuten im Bäckerladen nicht innerhalb einer dargestellten Wirklichkeit gegeben ist, sondern erst der Film selbst ihn herstellt, so wird hier... die Sprachlosigkeit der Menschen zu der des Films selber es ist die Erzählung ... es ist der Film selbst, der hier, angesichts der Ungeheuerlichkeit, aussetzt, verstummt, innehält.« (S. 73)
Und dann, um zu zeigen, wie sich das Erzählen des Films ganz im Gegensatz zu seinen Pionieren entwickelt hat: »Bei Griffith entsteht ... Erzählung ... aus den einzelnen Aufnahmen. / So entsteht sie auch nach jetziger Konvention; nur ist bei dieser eine Absicht... hinzugekommen: Erzählung ... soll entstehen..., als sei sie von sich aus vor handeln: die Illusion soll sich bilden, es würde nicht durch den Film eine Wirklichkeit dargestellt, hergestellt, sondern es sei eine Wirklichkeit für sich gegeben und gleichsam bloß gefilmt worden.« (S. 82)
» ... das Erzählen durch Wirklichkeitsillusion ... [ist] in den Filmindustrien und durch sie zum absolut geltenden ... Prinzip geworden. Die Folge war eine Ausschließung aller der anderen kinematographischen Möglichkeiten. / Es ist, als hätte damit der Film ... seine Bestimmung verfehlt, ganz zu der Kunst des 20. Jahrhunderts zu werden, wie er es hätte werden sollen. / Erst nunmehr ist für den Film eine Trennung entstanden von anonymer Überlieferung, Mythologie, Unterhaltung, Volkserzählung auf einer, und Experiment, Avantgarde, Kunst auf einer anderen Seite. Die Filmindustrien haben sich selbst zum Film überhaupt bestimmt und alles außerhalb von sich zum Nicht-Film und für unfilmisch, bis in das einzelne Bewußtsein hinein.« (S. 84/85)
»Das Singuläre dieses Films [A Corner...] ist, daß aus der kinematographischen Weltwahrnehmung und -darstellung die Abhandlung entsteht, die das Wahrgenommene, Dargestellte erhellt. Es ist, mit anderen Worten, bei Griffith das Darstellen mit dem Formulieren verbunden.« (S. 87)
Zum Schluß des Films: »der Bauer säend, allein ...; kein Pferdegespann, kein Knecht ... Dies kann eine Bedeutung in sich schließen des Sinnes: kein Knecht mehr zu halten, die Pferde verkauft ... Aber bei dem Film, wie er ist, hat solcher hinzugedachte Handlungssinn etwas von einer Verminderung eines Weltgeschehens zu doch bloß einer einzelnen Geschichte. Was zu sehen ist, ist heftiger« (schon vorher hat Färber einer Szene »antikische Heftigkeit zugesprochen) »...: Was am Anfang war als ein Leben, ist zerstört. Die Welt ist zerstört. Was der Film hier zuletzt vom Anfang nocheinmal herstellt, ist das langsame ruhige Zeitmaß, der weite Raum, und darin der eine Mensch, wie ein erster, ein letzter...: Wiederkehr des Anfangs und die Unmöglichkeit der Wiederkehr.« (S. 91)
Und zuletzt: »Der Film ist einzeln geblieben. Daß er so kühn erscheint, spricht gegen die Filmgeschichte.« (S. 93)
Einen Sehdenker habe ich Helmut Färber nach dem allen genannt, und wieder ist er dann auch noch jemand anderer; mehr? weniger? Mir scheint, mehr, in dem er, in den richtigen Schreibmomenten, weniger ist, oder weniger tut. (Und so kommen wir zurück zu Francesco Petrarca, oder Hermann Lenz, oder Gerhard Meier, oder zu den Gebrüdern Grimm, zu den Märchen, zu Donald Duck und zu den Gedichten.) Seltsam schon, wie sich mir beim Wiederlesen der Sachen Helmut Färbers die Art oder Unart des Unterstreichens umgeformt hat in ein Punktieren: Ich bin dazu übergegangen, oft und oft unter jedes einzelne Wort seiner Sätze und Absätze einen oder mehrere Punkte zu setzen. Das kam daher, daß ich die Wörter einmal ganz an ihrem Platz spürte, und auch mit den richtigen Zwischenräumen und Leerstellen. In dem Punkte-Setzen bin ich, der Leser, an dieser Prosa, zugleich mit dem Erkennen und Eine-Lehre Erfahren, ins Skandieren gekommen - also das Umgekehrte zu Färbers Griffith-Satz, wonach dort aus der Weltwahrnehmung die Abhandlung entsteht: anhand der Abhandlung erlebte ich ein Zurückübersetzen« (auch so ein Färber-Wort) in ein gleichsam taktangebendes Wahrnehmen. Gedanken, Bild und Gedicht werden bei diesem Wissenschaftler eins, zeitweise, und auch so vor übergehend, wie das eben der Fall ist und sich wohl auch gehört.
An einer Arbeit Helmut Färbers zeigt sich das tagklar, und von der möchte ich zuletzt ein bißchen was anklingen lassen. Denn ich habe noch nicht genug offenbar gemacht, wie der Autor immer sozusagen induktiv vorgeht, von einem Einzelnen zu einem Ganzen (ähnlich dem beschriebenen Verfahren in dem Griffith-Film), nach Goethes Maß. dichterisch, ein Urheber wenn nur je einer. Im Jahr 1988 haben die >>Akzentes einen langen Text Farbers publiziert, mit dem Titel „Das Grau und das Jetzt«, Aufzeichnungen aus den Jahren 1986-87, vor und zurück derart offen, daß zugleich klar wird, sie kommen aus einem weit größeren Zusammenhang. Aber auch so hängt der Ausschnitt zusammen, in einer leichten und dabei starken Verknüpfung: Festigkeit vereint mit Durchlässigkeit, dichterische Prosa. Es geht hier nicht mehr nur um gemachte oder Kunst-Gegenstände; die Betrachtung und Darstellung bewegt sich organisch hin und her zwischen Filmen, Gemälden, Bauten und Natur, Straßen-, Menschen-Bildern. Es sind geordnete und zugleich einander den Atem weitergebende Notizen, oder wie es in den Anfangssätzen heißt: »Daß alles Geschriebene ebenso raumherstellend und ebenso atmend sein möge wie ein Schweigen. Daß das Geschriebene gut sei, die Anschauungsenergie zu erhöhen.« Es ist eine »Wahrheitsform« (wieder so ein Färber- oder Goethe-Wort), welche in der Literatur, scheint mir, noch auf ihre Zukunft wartet. Angesetzt dazu haben erst wenige, vor allem Walter Benjamin und Botho Strauß. Wo man aber etwa in Benjamins »Moskauer Tagebuch“ bei all den frischen Ortsbeschreibungen viel andernorts schon Vorgedachtes liest und daneben des Schreibers Hektik und FastVerzweiflung spürt (er habe Journal geführt, sagt man, nur jeweils in Selbstmordnähe), läßt Färber sein Gewußtes meistens nicht immer - verschwinden im freien Anschauen, und statt der Gejagtheit spricht aus seinen Sätzen das Gleichmaß der Trauer, einer freilich monumentalen. Und von Botho Strauß scheidet ihn einmal schon, daß seine Notate noch nicht erweitert zum Buch erschienen sind - was sehr wünschenswert wäre - dann ihr Mangel an Allure, oder Sprachprotzentum; dann ihre Ortsfestigkeit an der Stelle des Orte-Flirrens (siehe »raumherstellend«). Die Sprache handelt vor allem in Paris, in einer ganz neuartigen Gemeinsamkeit von Innen- und Außenräumen, Erde und Unterirdischem, Jetzt und den Jahrtausenden. Nur unter sehr vielen anderen kommen in »Das Grau und das Jetzt« die Filme vor. »Menschheitsgeschichtlich, erkenntnisgeschichtlich ist die Kinematographie ein sehr kurzer Augenblick..., doch sie ist ein Blitz; eine vielleicht letzte, jedenfalls gänzlich unerwartete neue Möglichkeit des Zusammenwirkens von Erkenntnis und sinnlicher Erfahrung. - »Kino... Film: bestehend aus Licht und Dunkel./Video: Lichtmaterie verschiedener Helligkeit... Ende der Perspektive: (Das Videobild ist gegenüber dem Filmbild unräumlich.) / Ende der Tafelmalerei.c) Und aus dem vielen anderen möchte ich jetzt nur noch zitieren.
»Die Menschen Rembrandts: bei allen, auch Christus, ist zu sehen, zu spüren, daß sie aus Lehm geformt sind... Die Menschen haben inmitten der Schöpfung etwas Verlorenes, sie sind nicht das Ziel, die Mitte. Hütten im Wasserland, Behausungen, halb noch Erdhöhlen. Die ganze Welt ist noch nicht aus einem Dämmer herausgetreten ..., und das höchste befreiende Menschliche ist nicht die Tat, sondern das Sinnen.«
»Erkenntnis, das Schreiben - oft behindert, gefährdet durch den Erkenntnisgestus, der Satz durch die vorausgefühlte, gewohnte, gleichbleibenwollende Satzmelodie, der Gedanke durch die Gedankenform, die Anschauung durch die Sprache ...«
»Frage, jetzt, wie die offenbaren und geheimen Kräfte der Zerstörung und die geheimen der Erinnerung (und Wiedergeburt) sich gegeneinander verhalten. Aufgabe der Geschichtsforscher jetzt: das Unbekannte, gerade das nicht Erklärbare, nicht Ableitbare zu bemerken; Geringfügigstes kann sich später, was nur ein Kratzer, ein Sprung, eine abermaligste Wiederholung zu sein schien, kann sich als ein erstes, erst später verständlich werdendes Zeichen erweisen.«
»Und alle die greisenhaft verzweiflungsvoll häßlichen Hunde in den Straßen von Paris, alle wie nackt, wirklich die verkümmerten Nach kommen, Wiedergeburten dieser Drachen [auf zwei St. Georgs- und St. Michaels-Darstellungen von Raffael]. Irgendwann sind ihnen die Flügel verkümmert oder wurden ihnen abgeschnitten ... Ihre letzte Handlung und Rache, ehe sie aussterben: daß sie unaufhörlich ihre abgehauenen Drachenschwänze in den Straßen hinterlassen ... Aber die alten Mensch-Hunde-Paare ... die letzten Mischwesen, arm, hinfällig, elend.«
»Der Wunsch, die Liebe dazu, daß etwas dauere. Viele Möglichkeiten, ihn durch eingeschränktes Sehen sich zeitweise zu erfüllen. Wirklich aber erst, wenn alle Angst, selbst aller Schmerz vor der Vergänglichkeit ausgestanden ist, umgedacht. Es ist alles möglich. Es ist alles unbekannt.«
»Jetzt, die einzige rettende Farbe, die heilende, wiedererweckende, ist das Grau.«
»Mühe, Unvermögen, doch zuletzt auch ein Unbedürfnis, selber die Benjaminischen Zukunftserwartungen zu empfinden ... Es ist in Wirklichkeit auch bei B. nicht Erwartung, sondern der Erwartungsgedanke ... / Nichts windiger, katastrophaler, zerstückelnder, als derzeit intendierte Synthesen. Deshalb allein fortarbeiten ... Daß gelänge: Zugleich von Enthusiasmus und Trauer.«
»In Amerika haben auf eine bestimmte Weise die Farben eine andere Existenz. Alle Farben sind farbigste Farben. Der Widerspruch, der Konflikt zwischen künstlichen und natürlichen Farben besteht nicht. Alle Farben sind Buntfarben, können nichts anderes sein. Im Jahr 1945 wurde ein Gartencafé in einer deutschen Stadt zum Star-Club für die amerikanischen Soldaten hergerichtet und dafür als erstes der hölzerne Gartenzaun in orangelila und gelbtürkis gestrichen. Alle amerikanischen Farben sind wie von sich aus Reklamefarben, ohne dies eigens und ohne nur dies zu sein. Erst die törichte Roheit des europäischen Verlangens, auch Europa so amerikanisch farbig zu sehen, ergibt den ausschließlichen >Reklamecharakter der Kultur< ... / Bei Godard sind auch die Farben zitiert. [In dem Aufsatz zu Antonionis Die rote Wüste von 1965 hieß es: »Hier hat jede Farbe etwas von einer Entscheidung... Die Farbigkeit ist Antonionis >Formuliertes<.«]
»Ein Grau kann häßlich sein, starr, blind, tot, aber es gibt keines, das lügt. / Fleckiges Betongrau. Gebleichtes, geblichenes, unmerklich silbriges Grau der Bretterwände von Feldscheunen. Das stumpfe Olfarbblechgrau eines Fußgängerstegs über Bahngleise. Das mit reglosen trübweißen Splitterpunkten durchsetzte Asphaltgrau eines Bahnsteig bodens, an den Kanten rostfleckig von den Zügen. Weltgrau, Himmelsgrau, Schilfgrau, die rettende Farbe, Sehensfarbe, das Augenlicht.«
»Die Menschen haben seit längerem in vielem Einzelnen damit begon nen, sich selbst nicht mehr als Naturlebewesen zu begreifen, ihr eigenes Natursein nicht mehr zu wollen, es zu hassen. Sie schicken sich an..., ohne die Natur auszukommen, sie wegzulassen, zu verlassen, aufzugeben. Da sie bei diesem Unternehmen so viel zerstören, hat die Vorstellung von einer Erde wieder ohne Menschen etwas unendlich Erleichterndes, Erlösendes. Darüber möchte einer weinen, und hinausgehen und sich nicht mehr bewegen, in ein Stück Moorwiese, ein Bachufer, einen Stein auf dem Grund sich verwandeln.«
»Seitengasse beim Boulevard de Clichy..., ein Haufen Leute zusam menstehend um einen ..., der mit schreiender Rede seinen Feinden droht, in Unterwäsche auf die Straße herausgerannt, Gesicht und Schulter blutüberströmt. Ein Stück weiter in derselben Straße Leute zusammenstehend, aber sie warten, die Kinder vom Kindergarten abzuholen.«
»Im Jardin du Luxembourg war doch noch ein Kind gewesen, das Kastanien gesammelt hatte, und einmal vormittags gingen in der Rue Réaumur zwei kleine Jungen, mit Eifer einander erzählend, und führten sich dabei an der Hand.«
Und die letzte Notiz: »Nach langem Banshun von Ozu wiedergesehen, dann auch Soshun. / Später Frühling. / Früher Frühling. / Und mit einemmal war zu den Filmen und den Titeln von Ozu ein andrer seit langem geliebter Titel in den Sinn gekommen, als mit ihnen zusammengehörig, und jetzt für die Dauer ihnen verbunden: Verlassene Zimmer.«
Mit Helmut Färber ehren wir jemand ganz Seltenen: einen Lehrer, einen Forscher, einen Erstbesteiger, einen Kritiker - das will er zuletzt und von Anfang an doch wieder sein-, welcher zugleich, wie nur je ein großer Dichter, ein universaler Mensch, einer von allen ist.
(31.5.- 5.6.1994)