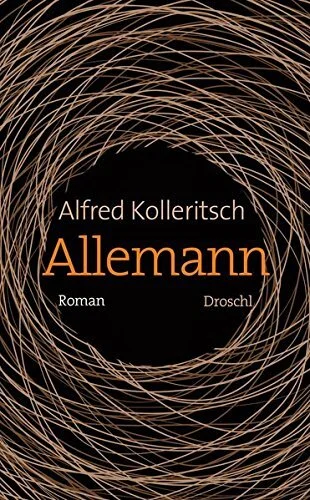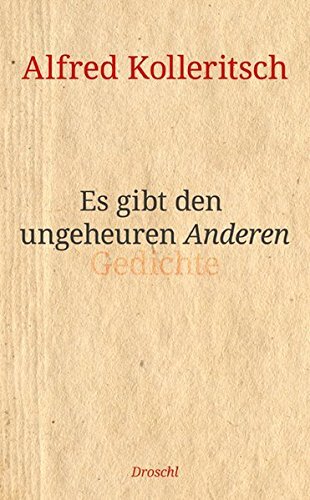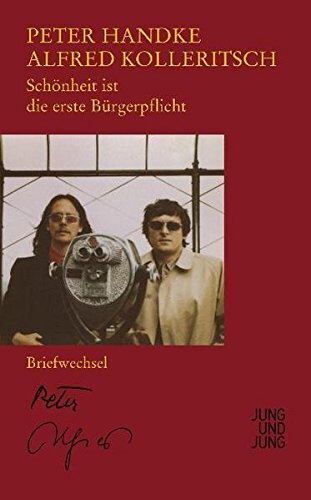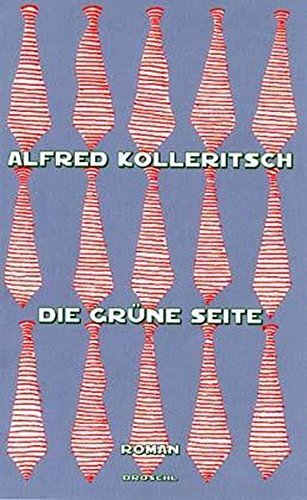Alfred Kolleritsch
Juror des Petrarca-Preises
geboren 1931 († 2020), ist seit 1960 der Herausgeber der Literaturzeitschrift "Manuskripte", einem wichtigen Organ zeitgenössischer deutscher Literatur.
Ausgewählte Publikationen
Ausgewählte Videobeiträge
Peter Handke
Der tiefe Atem
Rede zur Preisverleihung
Es wird schwierig sein, lieber Alfred K., sich Dir, wie Du es verdient hast, zu eröffnen, über die Kundgebung reiner Freude hinaus, daß Du das Gewaltige geschafft hast, im Verlaufe Deines Unterwegsseins mit den Gedichten, Sätze schreibend Dinge zu sagen. Erst den Atem beraubend, dann ihn ändernd, dann vertiefend, ist in Deinem Buch der Prozeß von der schamhaft tändelnden Schriftstellerhaltung unseres ausgehenden Jahrhunderts zurück (und voraus) zum schamlosen Ernst des archaischen Zungenredners; »klösterlich«, »mönchisch« nannte jemand, in einem einleuchtenden Paradox Deine mit Feuerzungen redenden Liebespoeme: im Zustand der Liebe als einer Gnade: »Daß du da bist,/daß ich da bin, und die glühende/schmelzende Grenze zwischen uns.«
Die Begeisterung über Deine Gedichte schließt nicht die Analyse aus, macht vielmehr erst die Lust zu derselben. In Deiner so selbstverständlichen, nicht gewollten, sondern sich dringend ergebenden philosophischen Sprache entdeckt man sich selber als Philosophen wiederseit der Kindheit war mein Philosoph. - Das ist Deine sanft-unabsichtliche Lehre.
Zu Beginn seines Abenteuers mit vorliegenden Gedichten gibt Herr Kolleritsch ein Bild von sich als das eines ziemlich zeitgenössischen Schriftstellerbastards; Lehrer, Literaturzeitschriftherausgeber, Verfasser eines Gedichtbandes und zweier Romane, in denen das eingeübte Sprachspiel der studierten Philosophie, wenn man kleinlich sein will, »vielleicht doch an manchen Stellen noch ein wenig...« usw. Eine ähnliche, nun aber eingestandene Zaghaftigkeit leitet auch die Einübung in das Vermeidbare ein »Meinen Einfällen vertraue ich nicht...«
Die Sprache des Beginns ist noch nicht ganz zum Sprechen befreit, sondern gehorcht teilweise so gefinkelt wie mutlos einem aktuellen Schreibkodex: »Das Finden reizvoller/ als das Suchen, / das gefundene Fressen/angenehmer als der Hunger. – ... ich halte mich hin, aber wie wie ein Saugnapf.« - Wortspiele, die sich als naheliegend, bloß mechanisch einstellen; der nicht vermiedene Magnetismus der » Gedicht-Sprache: Als starte unser Autor trickreich mit einem Idiom, das er selber gar zu gut versteht. »Ich sage zu mir«, heißt es im ersten Gedicht: Ein verzagtes Selbstgespräch.) Es schreibt noch der Sklave eines Vorverständigungssystems, an das die Identität notgedrungen zeitweise verkauft wurde. »Das Innere von früher war geborgt«: So die Anfangs-Einsicht. Auch in der Grammatik wird niemand angeredet in diesem ersten Gebilde: Nur das Ich, das mit sich von sich spricht, sattsam bekannt. Die herrschende Stimmung des Beginns (so wie die allzu lang schon herrschende Stimmung dieser Jahrzehnte): ALLES IST BLOSS WIEDERHOLUNG.
Doch dann, schon im zweiten Text, gleich die Wucht eines ungeklärten, mystischen Zeitsprungs: »Seither ist alles anders./Ich ging einen Schritt über mich hinaus.« Und die jähe Folge: Erstmals, als Erscheinung, das wunderbare Du in den Gedichten, diese für alles kommende mit der Kraft des Zusammenhangs, dem Stolz einer Geschichte, dem Pathos eines Gesangs befeuernd: das Du erscheint, weil es geliebt wird.
»Du hast mir die Todesanzeige gezeigt./Ich strich dir das Haar ins Gesicht.«
Und zugleich der gewaltige Klang vom ewigen Selbstzweifel des Liebenden: »Unnahbar, zu unnahbar bin ich./Nimm dieses glänzende Stück Eisen/und schlage die Wände ein.«
Das ist Deine Wucht, Alfred K.: das zeitgenössische Bewußtsein der Schwächlichkeit, der bloßen Wiederholung der Geschichten erfaßt zu haben - und zugleich ergriffen sein von der unerhörten Begebenheit Du, welches Dir eine Sprache gibt, in der Du es neu erfindest, dabei doch auf der dauernden, nicht nur aktuellen Zwiegespaltenheit der Wesen bestehend.
Zu solcher Gespaltenheit paßt, daß der Autor im heiligen Zustand der Liebe überall Feinde sehen muß; es ist ein Buch, in dem es von Feind-Vokabeln wimmelt: »Die Nominalisten horde rät mir/zu schreiben./Du bleibst das Besonderes.« - »Das unbewegliche Widerspruchsgesindel/braucht eine andere Bühne...« - »Abköche, die nicht lie. ben,/ daß wir Speisen genießen. Und selbst die Bilder personifiziert zu Feindlichem) »Sie fielen auf mich, /eine Rotte, / sie trug dich fort.« - Bis schließlich in der Sehnsucht nach der abwesenden Geliebten alles nur noch als »feindlich im Kreis stehend erscheint.
Hektisch beschwört der Liebende andrerseits in seiner Isolation die Freundschaften: »Der Freund, dem ich mein Leben als Atemschaum zeigte.« - »Diese Gedichte waren Vorwegnahmen/von Taten, schrieb ein Freund.« - Und doch treiben endlich »Freund und Feind.../auf dem Scherbenberg, wo die Straßen enden«; stehen »draußen« und halten »die Welt auf Distanz«.
Das Ich der Gedichte ist jedoch nicht distanzlos, sondern, für eine Zeitlang, die Welt geworden: das macht allein zuerst seine Größe aus - und dann auch, daß es seine Rückfälle in seine Meinung von sich als etwas von der Geschichte zu Ende Definiertes (die Wiederholungsvorstellung) nicht wegdichtet: immer wieder redest Du von einem bloßen »Spiel«, von »Bühne«, von »Vorhängen, von der »beweglichen Tragödie«. - »Diesem Schmerz sehe ich wie einem Tänzer zu,/ der ungelenken Marionette./Der Bühnenstaub fliegt auf, altes, zerbröseltes Theater.«
Im Fortgang Deiner Gedicht-Geschichte allerdings (ja, die Gedichte sind auch als eine Entwicklung zu lesen) sagst Du immer öfter: »Das Spiel ist aus«, »das Spiel war aus«. - »Du bist stumm,/ein beendetes Spiel.« - »Wenn ich zu dir auf die Bühne komme,/ ist das Spiel aus./ Wir gehen hinaus./Wo das Meer ist,/könnte ich schwimmen,/ wären wir eins geblieben.«
Die Einübung in das Vermeidbare ist eine Erzählung vom abenteuerlichen Verlauf einer Liebe: es wird also auch erzählt von der Angst dabei: vom Zeichensehen in der Angst, und wie, wenn die Liebe nicht mehr beantwortet wird, erst recht das Leiden an der Abwesenheit der Zeichen einsetzt: »Der Zeichenfresser sprach die Mauerschau./Und die Bäume sind kahl geworden, /eine nutzlose Wahrnehmung: /noch dein Name im Ohr. Und in der endgültigen Verlassenheit: »Niemand löschte das Zeichen von ihr. Auch das Zeichen hatte sie mitgenommen.«
Dieser Angst im Ausnahmezustand der Liebe entspricht weiter die Reiselust, ein Wegfahrzwang: als vertrügen sich das Ereignis Liebe und der angestammte Wohnort nicht: »... im Fluchtkleid, / ein Sandkorn,/ ein Körnchen für Rom, für Venedig, Paris.«
In seiner idealen Liebeserzählung (ideal, weil ohne den Erdenrest einer Individual-Story) gelangt Kolleritsch danach an jenen mythologischen Ort, wo der Sprechende sich und die Geliebte als Personen einer ewigen Handlung, als »ewige Dritte« sieht, als »er und sie«, und es wird deutlich, daß dies keine Distanznahme im Schreiben erst ist, sondern eine natürliche Station im Verlauf einer solchen Weltfahrt: was zuvor, episodisch, schon »wir beide« hieß, wenn auch mit Schlinggewächsen ins Fremde«, zerfällt zwischenzeitlich in zwei ganz fremde Personen: »Sie nahm ihn als abgetrocknete Haut von den Lippen/und soll gesagt haben, -das ist die Erinnerung-.«
Eine Station weiter zeigen die Gedichte wohl wieder die AnspracheGebärde - aber die geschieht tatsächlich schon in der Erinnerung (in der freilich noch deine Gegenwart siedet«): der Liebende und Verlassene sieht sich als jemanden, der einst zur Geliebten gesprochen hat: »Er sagte,/käme die Sonne, /ich würde nicht umschauen,/ich ginge dir nach.«
»Später« - so die nächste Station - »blieb die Erinnerung aus,/ Mückenschwärme zeigten an, wo sie war.../sie lachte über den Abbruch der Mauerschau.« Der Verlassene, nach dem ersten Jammer (»dem Feuergefühl hinter den Rippen«), beklagt sich jedoch nicht, sondern besinnt sich nicht trist und rhetorisch allein wie am Anfang, sondern in einer stolzen Trauer alleingeblieben, erscheint er von der Verlassenheit wie erleuchtet. Er besinnt sich auf seine Herkunft, seine Landschaft, seine Vorfahren, wird »Sohn« und »Enkel« von Heroen, deren Leben - und mit diesem das eigene - nun, nach dem Verlust, ohne Anstrengung in ihm auferstehen kann:es materialisiert sich hier in der Sprache das Gegenfest«, vergleichbar dem, das der Vater, das Jahr über ein Fürstendiener, am Ende des Jahres, in der Silvesternacht gegen die Herrschaft hielt. Die Gegenwart bedeutet zwar »Ungenießbarkeit« (»Ich wollte kochen, aber ich konnte nicht kochen.../den Wein trank ich mit./Ich merkte, daß ich kalt war,/ verschluckt von den Beispielen vergangener Tage«), doch aus der Vision der anders unseligen Generationen vor ihm gewinnt der Verlassene, »den Kreisgan hinter der eigenen Haut« übend, eine neue epische Sprache, und damit die Würde eines, der eine Geschichte hat.
Die letzte Station ist eine stolze Apotheose des poetischen Redens. welches dem Helden - so darf man ihn jetzt nennen - im Verlauf seines Abenteuers gelungen ist. Er hat die Geduld gewonnen, durch alles hindurch alles beim Namen zu nennen«: die Fähigkeit zum Epischen auch, als Zukunftsversprechen.
Seine Sprache strahlt nun von der» kühnen Macht, Abschied zu nehmen«, ohne die Metaphorik des Anfangs, ohne dessen Zitierzwang (»Dein Gesicht verbot das Zitieren«): »Vielleicht war die Luft leichter. /Dieser Abschied, sagtest du, ist die Begrüßung für immer...« Und triumphierend steht es dann da: »eine Lust zu natürlichen Zeichen/ tritt die Metapher ins Erdreich,/es ist die Hoffnung, alles anders zu sehen:/ die Welt wie eine gemeinsame Arbeit,/in der die Gefühle verteilt sind, / auch die Beobachtung, daß es weitergeht.« - Das Ich des Ausklangs schließlich, weil etwas durch eine Passion Gewonnenes, kann seine Feinde mit einer erhabenen Geste abwehren: »Es soll leiser werden um uns, / sagst du/andre sagen, es sei eine Schande ich zu sagen,/laut wie der geschwängerte Wagner.«Und zu guter Letzt, als gewaltig sanfte Nachschrift: »Etwas Warmes, fast Heißes/taucht auf, / die Liebe dazu,/ daß man es so gesagt hat.«
Lieber Alfred K., Du, in Deinem Beruf und dem täglichen Leben so vorsichtig wie listig, hast es, in der überraschenden, und schließlich überwältigenden Ganzheit eines Gefühls, welches durch das Buch hin triumphiert, auch in der Klage, geschafft, mit den guten alten Wörtern kühn und lieblich umzugehen, als kompetenter Sprecher, wie Dein Chomsky das nennt, oder als einer, der gewaltige Dinge weiß«, wie es in der Odyssee klingt. Zwar meldest Du Dich dazwischen noch als mißtrauischer Zeitgenosse: »Das Gefühl lauert./Es macht sich in Deinem Fortgang breit,/ ein bedenklicher Anlaß zu schreiben« - doch gerade dieses Mißtrauen stiftet mit die Authentizität Deines Werks. Ja: Deine Verse setzen, gegen die Zeitgenossen, gegen Dich selber, den Ernst eines Werks, welches uns, die wir diesen Preis zu vergeben hat ten, zuerst verstummen ließ, dann still begeisterte, dann ziemlich laut glücklich machte: Es war die Bescherung einer unverhofft lebendigen Zeit, ähnlich der Momente damals, als wir, bei der Lektüre der Gedichte Ernst Meisters, »es plötzlich wußten«.
Der Sinn des Petrarca-Preises, vor einem Jahr fast vergessen in der Überfrequenz eines bloß mondänen, nicht einmal neugierigen Dabeiseins und der Demagogie eines verelendeten Journalismus, ist mit diesen Gedichten wieder selbstverständlich da. Das Bedeutende an Deiner Poesie ist, daß sie, alle Schutzsysteme wegdenkend und wegsprechend, mich zwingend fragt: Wer bist Du, der das liest? Und: Wie konntest Du Dich vergessen? (Das ist ihre, so erwachsene wie kindliche Philosophie...) - Und gibst mir dann höchst selbst diese erlösende Antwort: »Feldein kommen Namen für dich. /Wunderbar schwer zu überzeugen,/stehle ich mich zu Sätzen zusammen,/in ihnen öffnest du deine Augen.«
Das ist es: Auch der Lesende wird das Geliebte dieser Gedichte.
Mein lieber Freund (so fangen allzuoft Drohungen an), sei bedankt für die durch Deine sprechenden Dinge lebendig gewordene Zeit. Den andern empfehle ich, einen Tag mit der Einübung ins Vermeidbare zu verbringen. Denn: »Die Freunde sind Ritter,/ die Rüstungen glitzern, auf einmal rasseln die Brücken herab.«